Pathological Demand Avoidance (PDA) – ein im deutschsprachigen Raum noch wenig bekanntes Profil einer Autismus-Spektrum-Störung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen
Die ICD-111 hat in ihrem Kapitel über Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) den Aspekt aufgenommen, dass gewisse Kinder im Autismus-Spektrum eine sehr auffällige Vermeidung von Anforderungen (Demand Avoidance) zeigen. Außerdem wird festgehalten, dass Kinder mit ASS oft ein störendes Verhalten mit aggressiven Ausbrüchen aufweisen, welches differentialdiagnostisch von einer Störung des Sozialverhaltens abgegrenzt werden muss. Des Weiteren wird in der ICD-11 auch das Masking, also die Tatsache, dass sich ASS Betroffene in gewissen Settings durch außergewöhnliche Anstrengungen unauffällig zeigen können, klar umschrieben.
Das Ihnen hier vorliegende Schreiben hat das Ziel, Ihre Aufmerksamkeit für PDA zu gewinnen. Wir erachten PDA als ein Syndrom, welches ein noch wenig bekanntes Profil einer Autismus-Spektrum-Störung darstellt. Unsere Meinung ist dabei an diejenige der PDASociety angelehnt. PDA wird aufgrund unzureichender Forschung und dürftiger Studienlage kontrovers diskutiert, was leider auch den Hypothesen den Raum öffnet, dass PDA lediglich ein Verhaltensprofil darstellt, welches sich durch ungünstiges Erziehungsverhalten oder Psychopathologien von Eltern ausbildet.2
Unser Schreiben stellt im Wesentlichen eine Zusammenfassung des von einer Expertengruppe der PDA Society 01/2022 verfassten diagnostischen Leitfadens für das PDA-Profil dar.3 Der Begriff PDA wurde in den beginnenden 1980ern durch Elizabeth Newson (Professorin für Entwicklungspsychologie, Nottingham) geprägt und 2003 wurde erstmals ein Artikel zu PDA publiziert.4 Newson sah PDA als eine spezielle Form einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung an. Sie beschrieb eine Gruppe von Kindern, die an Autismus erinnerten, aber nicht komplett in dieses Raster fielen. Die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, zu welchen auch der Frühkindliche Autismus, der Atypische Autismus und der Asperger Autismus gehören, werden in der ICD-11 weitgehend unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störungen subsummiert. Das wichtigste Merkmal einer PDA ist die Vermeidung von alltäglichen Anforderungen wie Essen, Zähneputzen, Anziehen, Schulbesuch. Die Betroffenen vermeiden diese Aufgaben nicht, weil ihnen die Tätigkeit an sich unangenehm ist, sondern weil jedes Erkennen einer Anforderung zu einer extremen Angst und damit zu einem hohen Bedürfnis nach Kontrolle führt.5 Somit werden selbst lebensnotwendige oder von ihnen geliebte Tätigkeiten vermieden, was sich oft zu ihrem eigenen Schaden auswirkt. Denn jede von außen oder auch von innen, also von ihnen selbst, an sie gestellte Anforderung kann zu einer Fight-Flight-Freeze-Reaktion und damit zu extremen, teilweise schockierenden Verhaltensweisen dieser Kinder führen.
Eine Prävalenzstudie, die auf den Färöer Islands durchgeführt wurde und bei welcher PDA mittels einiger Interviewfragen (DISCO) erfasst wurde, wies darauf hin, dass bei 20% der Kinder mit einer ASS-Diagnose ebenfalls gewisse Symptome einer PDA vorliegen. Bei 4% der ASS-betroffenen Kinder war auch ein sozial manipulatives Verhalten feststellbar, so dass die Diagnose PDA gestellt werden konnte.6
Haben Sie in Ihrer beruflichen Praxis auch schon Kinder gesehen, welche ein verwirrendes Verhalten aufzeigen, das System sprengen und durch alle diagnostischen Maschen fallen? Haben Sie bei einigen Kindern die Diagnose einer Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert, ohne irgendwelche auslösenden Faktoren in der Anamnese zu finden? Kennen Sie Schilderungen darüber, dass Kinder in verschiedenen Settings ganz unterschiedliche Gesichter zeigen? Haben Sie Kinder beobachtet, welche extrem rasche Stimmungswechsel zeigen – in einem Moment charmant und liebenswürdig und im nächsten herrisch und dominierend auftreten? Haben Sie hilfesuchenden Eltern zugehört, die ihr Kind oft schon seit der Säuglingszeit als irgendwie anders wahrnehmen, jedoch nie eine erklärende Diagnose für das Verhalten ihres Kindes erhielten? Haben Ihnen offensichtlich sehr auf das Kindeswohl bedachte Eltern geschildert, dass sie beim Grenzensetzen immer wieder gravierende Meltdowns ihrer Kinder erleben und daher keine andere Möglichkeit sehen, als dem Kind sehr viel Autonomie einzuräumen? Sind Ihnen Kinder aufgefallen, welche oft keine Autoritäten (an-)erkennen und sich zwanghaft bestrebt zeigen, immer die Kontrolle über jede Situation zu behalten? Haben Sie PatientInnen begleitet, welche trotz guter Intelligenz, trotz intensiver konventioneller Behandlungsmethoden und trotz sehr engagierten Eltern und LehrerInnen in ihrer Entwicklung in eine nicht erklärliche Negativspirale gerieten, in der Schule weit unter ihrem Intelligenzniveau abschnitten oder den Schulbesuch komplett verweigerten und denen es schließlich nicht gelang, eine Berufsausbildung zu absolvieren?
Falls viele dieser Punkte auf PatientInnen von Ihnen zutreffen – dann könnte der Grund dafür ein PDA-Profil einer Autismus-Spektrum-Störung sein. Wenn wir die Autismus-Spektrum-Störung als dimensionales Konstrukt begreifen, dann stellt PDA eine der möglichen Dimensionen im Spektrum dar. PDA-Betroffene weisen ebenfalls typische autistische Besonderheiten in der sozialen Interaktion, den Verhaltensmustern, der Interessensteuerung und der Sensorik auf. Allerdings werden diese aufgrund des mit PDA einhergehenden hohen Maskings oft nicht oder erst bei genauem Nachfragen erkannt. Das Masking kann in stationären Einrichtungen oft über Wochen beibehalten werden. Dies resultiert dann aber in umso schwereren Meltdowns im häuslichen Umfeld. Sehr oft erreichen PDA-Betroffene den Cut Off in den gängigen ASS-Tests nicht, denn sie scheinen oberflächlich sozialer, ja zeigen sogar oft Spezialinteressen im sozialen Bereich (z. B. völliges Fixiertsein auf eine Person). Ebenso lieben einige von ihnen das Rollenspiel und können darin sogar ihre Demand Avoidance teilweise überwinden. Man muss jedoch betonen, dass das soziale Verständnis von PDA-Betroffenen nur oberflächlich und die Fähigkeit zur sozialen Perspektivenübernahme genau wie bei „normaler“ ASS beeinträchtigt ist, was immer wieder zu Konflikten und Missverständnissen führt. Overloads, Meltdowns und Shutdowns kommen bei PDA-Betroffenen sehr häufig vor, was insgesamt zu einer hohen Belastung führt. Dem diagnostischen Erkennen dieses Profils ist aus unserer Sicht trotz relativ geringer Prävalenz eine hohe Wichtigkeit zuzuordnen, weil Betroffene und ihre Familien oft mit einem immensen Leidensdruck leben. Wenn die Diagnose nicht erkannt wird, tragen die Familien nämlich eine mehrfache Last. Einerseits erhalten sie keine Erklärung für das höchst herausfordernde Verhalten ihres Kindes und somit kann keine hilfreiche Unterstützung angeboten werden, andererseits sind sie extremen Anschuldigungen betr. ihres keine Wirkung erzielenden Erziehungsstils und den damit verbundenen Selbstzweifeln und Schamgefühlen ausgesetzt. Im Gegensatz zu anderen Profilen einer ASS profitieren PDABetroffene auch nicht von gängigen ASS-Strategien (Struktur/visuelle Pläne/Routine etc.). Ganz im Gegenteil führen diese Methoden oft zu einer dysfunktionalen Zirkularität und damit zu einer weiteren Eskalation des Verhaltens. Falls aber keine oder eine falsche Diagnose gestellt wird, verschlechtert sich die Prognose der Betroffenen in hohem Maße. Ohne das Wissen über ihre spezielle Beeinträchtigung entwickeln sie einen extrem niedrigen Selbstwert, fühlen sich schuldig für ihr sonderbares, widerspenstiges Verhalten und führen auch im Erwachsenenalter oft noch einen selbstschädigenden Lebensstil.
Mit Ihrer Aufmerksamkeit für dieses besondere Autismus-Profil können Sie zu einer wesentlichen Verbesserung der Prognose der PDA-Betroffenen beitragen. Denn wenn die Ursache der Anforderungsvermeidung erstmals gefunden ist, können hilfreiche Strategien eingeführt und die schädigende Negativspirale unterbrochen werden. Der von der Expertengruppe der PDA Society verfasste diagnostische Leitfaden zur Erkennung des PDAProfils wurde von mir übersetzt, dies mit dem Ziel, das Erkennen von PDA und das vertiefte Verständnis über dieses Krankheitsbild auch im deutschsprachigen Raum zu fördern. Sie finden den Leitfaden unter: https://www.pdasociety.org.uk/resources/resourcecategory/international/
Eine Zusammenfassung der in diesem Dokument genannten wichtigsten Merkmale, welche auf ein PDA-Profil hinweisen, habe ich in einer Checkliste festgehalten, welche Ihnen im Anhang 1 zur Verfügung steht. Natürlich ist diese Auflistung kein evaluiertes diagnostisches Instrument. Es gibt keinen Cut Off, welcher klar für oder gegen die Diagnosestellung eines PDA-Profils spricht. Die Diagnose eines PDA- Profils erfordert selbstverständlich Ihr fachkundiges Urteil auf der Grundlage Ihrer Erfahrung und den von verschiedenen für die ASS-Diagnostik relevanten Quellen.
Falls Sie schließlich zu dem Schluss kommen sollten, dass ein PDA-Profil die beste Erklärung für die vorliegende Symptomatik Ihres Patienten/Ihrer Patientin ist, dann können folgende Strategien meist zu einer wesentlichen Entlastung führen:
- Flexible, kooperative Ansätze, die eher das Gefühl der Autonomie als ein Gefühl der Kontrolle durch andere fördern; dennoch angemessene Grenzen wahren
- Indirekter Kommunikationsstil und entpersonalisierende Aufforderungen
- Anwendung von Strategien, welche ein niedriges Erregungsniveau anstreben (low-arousal)
- Genügend Zeit lassen, um Fragen/Informationen zu verarbeiten; Kommunikation nicht übereilen
- Reizüberflutung vermeiden
- Individuelle Planung, welche Prioritäten festlegt und darauf abzielt, die Anforderungen an die Belastbarkeit sowie die Erwartungen an den Grad der Ängstlichkeit anzupassen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Sozialdiensten etc., um ein gemeinsames Verständnis und ein koordiniertes Vorgehen für die Unterstützung zu fördern
- Es ist zu prüfen, ob eine medikamentöse Behandlung von Begleiterkrankungen wie Angstzuständen und/oder ADHS angebracht ist und ob in manchen Fällen auch eine Ergo- oder Sprachtherapie hilfreich wäre.
Die PDA Society hat die wichtigsten hilfreichen Strategien im PANDA-Konzept festgehalten:

Die PANDA-Approaches werden in folgendem Dokument, welches Sie auf der Website der PDA Society finden, genauer ausgeführt: https://www.pdasociety.org.uk/resources/panda-approaches-in-german/
Ebenfalls bietet das Dokument „Keys to Care“ einen guten Überblick über die bei PDA
hilfreichen Strategien: https://www.pdasociety.org.uk/resources/keys-to-care-in-german/
Nun danke ich Ihnen für Ihre Offenheit und Ihr Interesse an PDA. Viele von PDA betroffene Familien erleben von Fachpersonen leider weiterhin eine große Abwehr, wenn sie den Verdacht auf ein PDA-Profil bei ihrem Kind aussprechen. Oft wird lieber am Konzept festgehalten, dass die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder versagt haben und aufgrund des extrem hohen Maskings dieser Kinder wird nicht an das Vorliegen einer Neurodivergenz gedacht. Die unkonventionellen Erziehungsmethoden der Eltern unterstützen dann meist diese Hypothese, ohne dass an zirkuläre Prozesse gedacht wird. Dies führt viel zu oft dazu, dass diese Familien mit ihrem Leid alleine gelassen werden. Ich bin Psychiaterin in eigener Praxis mit systemischer und schematherapeutischer Ausbildung und habe mich unter anderem auf die Diagnostik und Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen im Erwachsenenalter spezialisiert. Ich halte es für sehr wichtig, dass von PDA betroffene Familien in Zukunft mehr Verständnis und Unterstützung erfahren. Eine frühe Diagnosestellung und das Erarbeiten eines gemeinsamen Verständnisses für die Besonderheiten bei PDA sowie das Anwenden von geeigneten PDA-Strategien können die Prognose der Betroffenen wesentlich verbessern. Seit einiger Zeit begleite ich daher Eltern von betroffenen Kindern systemisch in meiner Praxis. Es würde mich überaus freuen, wenn auch Sie in Zukunft zur Unterstützung dieser Kinder und ihrer Familien beitragen werden.
Für Fragen stehe ich Ihnen sehr gerne auch im persönlichen Austausch zur Verfügung.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Dr. med. N. Chou-Knecht
FMH Psychiatrie und Psychotherapie
Präsidentin Schweiz, Fachverein PDA-Autismus-Profil
Schönenwerd, 27.4.2023
Anhang
Literatur
- International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD–11) World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11 (CC BY-ND 3.0 IGO), Foundation URI: http://id.who.int/icd/entity/437815624 (accessed 2022–06–02)
- Inge Kamp-Becker, Ulrich Schuh und Sanna Strot1, 03/2023, Pathological Demand Avoidance – aktueller Forschungsstand und kritische Diskussion, Horgrefe online
- Multidisciplinary group of professionals working in the NHS and private practice, PDA Society (2022) Identifying & Assessing à PDA profile – Practice Guidance
- Newson et al (2003) Pathological demand avoidance syndrome: a necessary distinction within the pervasive developmental disorders. Archive of Diseases in Childhood.
- Stuart, L., Grahame, V. , Honey, E. & Freeston, M. (2020). Intolerance of uncertainty and anxiety as explanatory frameworks for ext-reme demand avoidance in children and adolescents. Child & dolescent Mental Health, 25, 59–67. https://doi.org/10.1111/camh.12336 sowie White, R., Livingston, L.A., Taylor, E .C., Close, S.A .D., Shah, P. & Cal-lan, M. (2022). Understanding the contributions of trait autism and anxiety to extreme demand avoidance in the adult general population. Journal of Autism and Developmental Disorders, ht-tps://doi.org/10.1007/s10803-022-05469-3
- Gilberg et al (2015) Extreme („pathological“) demand avoidance in autism: a general population study in the Faroe Islands. European Child and Adolescent Psychiatry
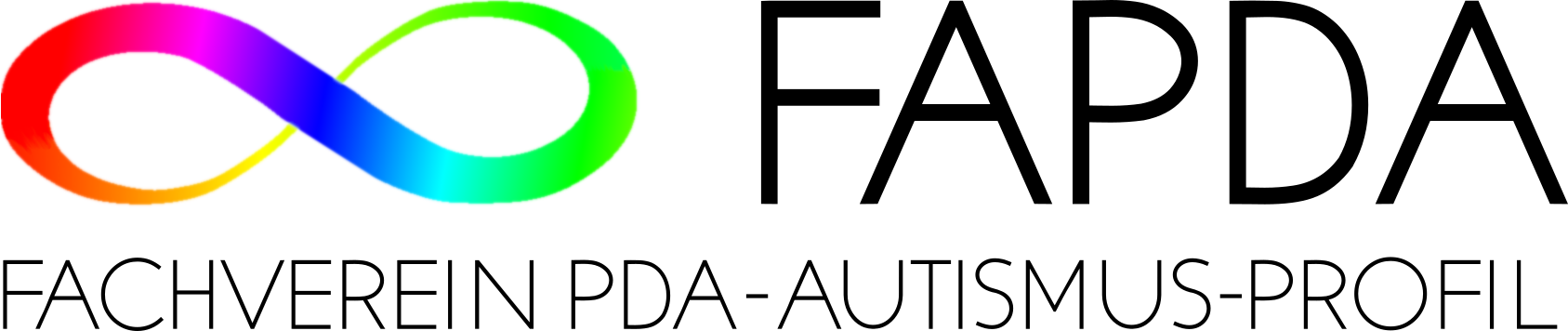
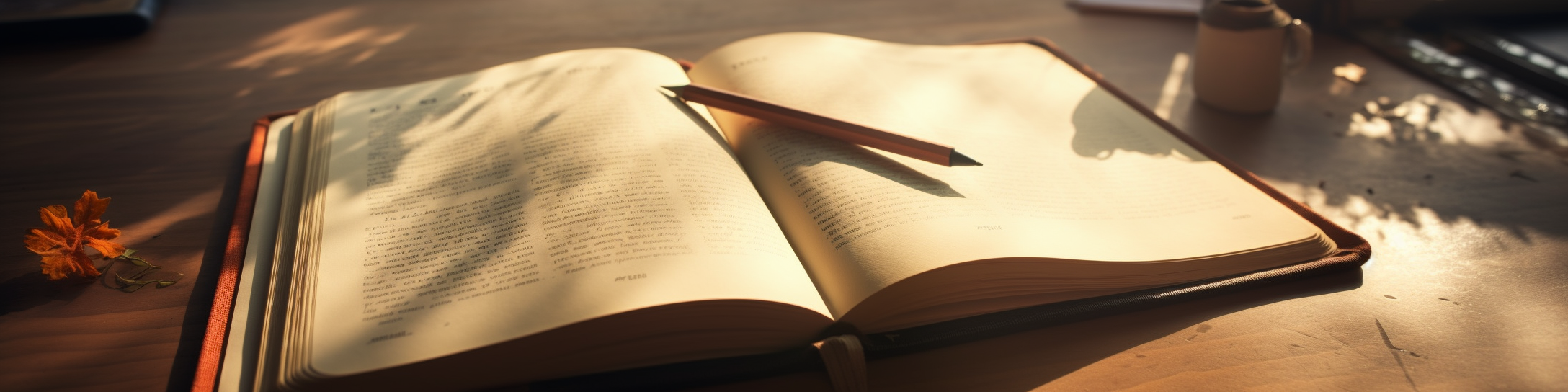
Sehr geehrte Frau Chou-Knecht,
ich bin Fachärztin für Kinder – und Jugendpsychiatrie, teils in eigener Praxis tätig. Mich überhäufen PDA-betroffene Familien mit Anfragen zur Diagnostik und Begleitung, denen ich sehr gerne Unterstützung anbieten möchte. Heute möchte ich Sie erstmal fragen, ob ich die Inhalte Ihrer PDA Checkliste, bzw. Brief an ASS – Abklärungsstellen als Argumentationsgrundlage in den Diagnoseberichten für die betroffenen Kinder verwenden darf? Es ist so unendlich viel Aufklärungsarbeit notwendig. Gerne hätte ich perspektivisch auch mehr Kontakt und Austausch mit Ihnen bzw. dem Verein.
Danke für kurze Rückmeldung und liebe kollegiale Grüße, Kerstin Heineken
Sehr geehrte Frau Chou-Knecht, wir haben einen 6 jährigen Sohn der zu 1000 % auf diese Aussagen zutrifft.( Der Tip für PDA kam von unserer Erzieherin) Wir werden derzeit auf ADHS medikamentös eingestellt, aber der Arzt lässt uns hier komplett alleine( keine Rückmeldungen etc) mein Sohn bekommt immer häufiger Wutanfälle je älter er wird und zur Zeit immense Probleme wegen Aggressionen im Kiga je weiter es auf die Schule zugeht. Seine Auffälligkeiten reichem schon von Baby Alter an. Wir sind sehr sehr verzweifelt weil wir unsere Erziehung schon in Frage stellen aber wir keine Ahnung mehr haben an wen wir uns noch wenden können:( hätten Sie einen Tip für uns?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Lena Heitmann
PS: Mutter: Asperger
Vater: ADHS
Liebe Lena,
Sie sind sicher nicht alleine. Es geht sehr vielen Eltern so, dass sie verzweifelt nach Hilfe suchen. Beim Fachverein sind Sie für Erstanfragen schon mal richtig. Nur hier bei den Kommentaren kommt Ihre Anfrage leider nicht bei der zuständigen Person an. Könnten Sie Ihr Anliegen deshalb bitte direkt über das Kontaktformular stellen? Liebe Grüsse, Anja